
Im vergangenen Jahr hat sie um diese Zeit üppig geblüht, nun hat sie gerade mal ein paar Blätter. Sie ist also wieder schlecht über den Winter gekommen, aber sie wird sich in den nächsten Wochen erholen. Seit 2010 wächst sie nun schon, ein wenig versteckt, zwischen den Wirtschaftsgebäuden im nichtöffentlichen Bereich des Botanischen Gartens. Im Winter bekommt sie über den Wurzelbereich eine Abdeckung aus Laub und Reisig, um sie vor starkem Frost zu schützen. Außerdem hat sie ein Klettergestell, denn alleine aufrecht wachsen, kann sie nicht. Muss sie auch nicht. In ihrer Heimat im südlichen China lebt sie als wilde Schlingpflanze in offenen Wäldern und Buschland und bildet bis 8 m lange Triebe. In gut gepflegten Gärten wird so ein ungezügelten Verhalten aber nicht gern gesehen. Also Klettergestell.
Die Wattakaka – zum Namen kommen wir noch – gehört zu einer vorwiegend tropisch-subtropisch verbreiteten Gruppe der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae subfam. Asclepiadoideae), die bei uns nur durch die Weiße Schwalbenwurz (Vincetoxicum hirundinaria) vertreten ist. Enger verwandt mit der schönen Wattakaka sind jedoch die Wachsblume (Hoya carnosa) und die Kranzschlinge (Stephanotis floribunda), beides erstklassige Zimmerpflanzen, die aus Südostasien bzw. Madagaskar stammen.
Das Außergewöhnliche an dieser Verwandtschaftsgruppe, die weltweit etwa 2.300 Arten umfasst, ist der komplexe Mechanismus zur Übertragung des Pollens bei der Bestäubung. Bei fast allen Blütenpflanzen läuft das ja relativ simpel: die Pollensäcke der Staubblätter reißen auf, und dann übertragen der Wind oder Insekten die Pollenkörner auf die Narben andere Blüten. Das ist zwar nicht immer zielsicher, funktioniert alles in allem aber offensichtlich gut. Die Wattakaka und ihre Verwandten machen es anders: Sie bilden wie die Orchideen elegante Pollenpakete, von denen hier immer zwei - jeweils eines aus zwei benachbarten Staubblättern - über einen sogenannten Klemmkörper verbunden werden.
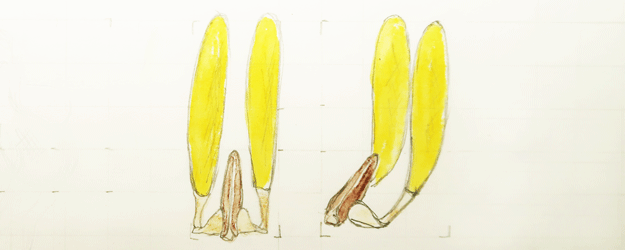
Dieser Klemmkörper hat einen schmalen, sich nach oben verjüngenden Spalt, in dem sich blütenbesuchende Insekten mit den Borsten ihrer Beine oder den Mundwerkzeugen verfangen. Befreien kann sich das Insekt dann nur, indem es den Klemmkörper mit den beiden Pollenpaketen aus der Blüte herausreißt. Beim Besuch der nächsten Blüte dieser Art wird das Pollenpaket dann in einer ähnlichen Bewegung in einem Spalt zwischen den Staubblättern abgestreift und gelangt auf den empfängnisfähigen Teil der Narbe, der sich an der Unterseite des Griffelkopfes befindet. Ganz gut beobachten kann man solche abgestreiften Pollenpakete bei den Seidenpflanzen der Gattung Asclepias, die aufgrund ihres Nektarreichtums stark von Bienen besucht werden.
Um die Insekten beim Blütenbesuch in die richtige Position für das Anheften oder Abstreifen der Pollenpakete zu bringen, gibt es auf dem Rücken der Staubblätter oft dicke Knubbel, mit Nektar gefüllte Hörnchen oder andere Nebenkronen. Der Klemmkörper mit seinem beiden Ärmchen, das muss man noch erwähnen, ist keine zelluläre Struktur, sondern formt sich aus einem Sekret des Griffelkopfs. Es gibt in den Hundsgiftgewächsen zum Glück ein paar einfachere Vorstufen, so dass man den Glauben an die Zufälligkeit der Evolution hierbei nicht gänzlich verlieren muss.
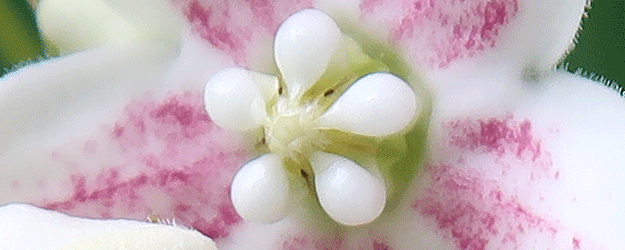
In den Blüten unserer Wattakaka kann man die filigranen, dunkelbraunen Klemmkörper zwischen den fünf weißen, tropfenförmigen Anhängseln der Staubblätter gerade so erahnen. Um die nur knapp 1 mm langen Pollenpakete zu sehen, muss man die Spitzen der Staubblätter entfernen. Das gelingt aber nur mit feinsten Pinzetten und unter der Vergrößerung eines Stereomikroskops. Die faszinierendsten Strukturen verbergen sich leider häufig hinter der Grenze zum Mikrokosmos.
Wattakaka - wer denkt sich so einen Namen aus?
Schon allein wegen dieser exquisiten Blütenstrukturen ist die schöne Wattakaka für Pflanzenliebhaber ein Muss. Der zweite Grund ist der betörend gute Duft der Blüten, das muss man jetzt einfach mal glauben. Und der dritte Grund ist natürlich der extravagante Name – Wattakaka! Wer denkt sich nur so was aus?
Das ist nicht leicht zu beantworten. Zur Herkunft der botanischen Pflanzennamen gibt es etliche Wörterbücher, Wattakaka ist darin aber selten erwähnt. Man muss also schauen, wer die Gattung Wattakaka erstmals wissenschaftlich beschrieben hat. Das war Justus Karl Haßkarl im Jahre 1857. Haßkarl, 1811 in Kassel geboren, hatte zunächst Gärtner gelernt und dann in Bonn Naturwissenschaften studiert, bevor er 1836 für sieben Jahre nach Java ging und dort eine Anstellung im Botanischen Garten Bogor fand. In dieser Zeit entdeckte und beschrieb er zahlreiche neue Pflanzenarten. Haßkarl kehrte dann nach Europa zurück und reiste 1852 im Auftrag des Niederländischen Kolonialamts nach Peru, um Jungpflanzen der Chinarindenbäume zu beschaffen (illegal) und nach Java zu überführen. Wer im tropischen Südostasien wirtschaftlich und politisch vorankommen wollte, brauchte ein Mittel gegen Malaria. Da führte am Chinin der südamerikanischen Chinarindenbäume (Chinchona) kein Weg vorbei. Die englische Ostindienkompanie verfolgte das gleiche Ziel in Indien.
Haßkarl war mit der Einführung einer Chinarinden-Baumart nach Java erfolgreich, musste aber 1856 aus gesundheitlichen Gründen nach Europa zurückkehren. Zuvor hatte sich eine persönliche Katastrophe ereignet: Seine Frau mit vier Kindern waren auf der Überfahrt zu ihm nach Java ums Leben gekommen. Nach seiner zweiten Rückkehr nach Europa publizierte Haßkarl zahlreiche weitere Pflanzennamen, am Ende sind es 1.103 Namen, die sein Autorenkürzel „Hassk.“ tragen. Darunter die Gattung Wattakaka mit der damals einzigen Art Wattakaka volubilis aus Indien. Aber Haßkarl hat sich diesen Namen nicht selbst ausgedacht. Er hat ihn aus dem Hortus Malabaricus übernommen, einem Mammutwerk, das zwischen 1678 und 1693 in zwölf Bänden vom niederländischen Gouverneur der Malabarküste, Hendrik van Rheed, herausgegeben wurde.
Der Hortus Malabaricus war die erste gedruckte Flora der tropischen Pflanzenwelt Südasiens. Er umfasst etwa 740 Pflanzenarten der Malabar-Region mit umfangreichen Beschreibungen, ethnobotanischen Angaben zur medizinischen Verwendung und ist durchgehend mit großformatigen, sehr präzisen Kupferstichen illustriert. Ein herausragendes Werk der frühen botanischen Erforschung Indiens, das auch auf ältere regionale Quellen zurückgreift. Die Namen der Pflanzen werden darin in mehreren Sprachen angegeben, wobei ihre Übertragung in unsere lateinische Schrift auf der südwestindischen Sprache Malayalam basiert. Oder zumindest so weit diese Übertragung damals möglich war. Die von Haßkarl wissenschaftlich benannte Art Wattakaka volubilis trägt im Hortus Malabaricus den Namen Watta-Kaka-Codi. Andere Pflanzen im gleichen Band heißen etwa Kudici-Kodi, Belutta-Kaka-Kodi, Wallia-Pal-Valli oder Njota-Njodem-Valli, das ist die zauberhafte Leuchterblume Ceropegia candelabrum.
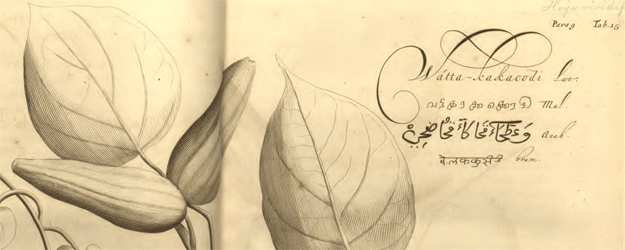
Es fällt auf, dass keine der Pflanzen im Hortus Malabaricus einen beschreibenden lateinischen Namen oder eine Benennung nach einer bedeutenden Person erhält. Diese Unsitte – Namengebung als Anbiederung an die Herrschenden, als Form der Machtausübung oder als Gefälligkeit unter Kollegen – kam erst später auf. Unsere schöne Wattakaka zählt zu den relativ wenigen Pflanzen, deren wissenschaftliche Benennung auf einem indigenen Namen basiert.
Ob das so bleiben wird, ist aber ungewiss. Die wissenschaftlichen Pflanzennamen können sich ändern, wenn es neue Forschungsergebnisse zur Evolutionsgeschichte der entsprechenden Pflanzengruppe gibt. Und im Umfeld der Gattung Wattakaka, die etwa fünf Arten von Indien bis China und im malaiischen Raum umfasst, fehlen moderne phylogenetische Untersuchungen. So wird unsere schöne Wattakaka sinensis an vielen Stellen auch unter dem Synonym Dregea sinensis geführt, benannt zu Ehren von Johann Franz Drège (1794-1881), einem deutschen Pflanzensammler in Südafrika. Letztlich wird es aber wahrscheinlich auf eine Eingliederung in die große Gattung Marsdenia hinauslaufen, die an den Sumatra-Forscher und späteren First Secretary to the Admirality der Britischen Navy, William Marsden (1754-1836) erinnert. In beiden Fällen kämen die Namenspatronen dann wie so oft aus dem Kreis der „alten weißen Männer“ der kolonialen Wissenschaftsgeschichte. Das wäre schade. Darum, lang lebe die schöne Wattakaka!
Literatur
Kräusel, Richard, „Haßkarl, Justus Karl“ in: Neue Deutsche Biographie 8 (1969), S. 50 [Online-Version] URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118709003.html#ndcontent
Rhees, Hendrik van (1689). Hortus Indicus Malabaricus, Vol. 9. URL: https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/707
Link zum Garden Explorer: Wattakaka sinensis im Botanischen Garten
Text und Fotos: Dr. Ralf Omlor | 07.07.2021
